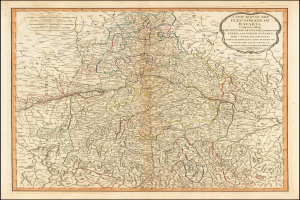Gockels 'Wallenstein'-Premiere: Eine Mischung aus Geschichte, Humor und Kontroversen
 Admin User
Admin UserGockels 'Wallenstein'-Premiere: Eine Mischung aus Geschichte, Humor und Kontroversen
Jan-Christoph Gockels Inszenierung von Schillers "Wallenstein" feiert Premiere an den Münchner Kammerspielen Am 4. Oktober 2025 hatte Jan-Christoph Gockels Bearbeitung von Friedrich Schillers Wallenstein an den Münchner Kammerspielen Premiere. Die Produktion bezog aktuelle Recherchen über russische Wagner-Söldner ein und lotete die Themen Krieg, Verrat, Macht und Liebe aus – mit deutlichen Bezügen zu gegenwärtigen Konflikten. Gockel und sein Team kürzten Schillers Text stark und ergänzten ihn durch Prologe, Epiloge und eigene Einwürfe. Das Ensemble begann die Aufführung in einer Küche, wo die Schauspielerinnen kochten und mit dem Publikum interagierten, bevor sie sich in Bauern und Soldaten verwandelten. Die Liebesgeschichte zwischen Wallensteins Tochter und Max Piccolomini wurde zwar oft humorvoll inszeniert, wirkte aber zwischen einer Abfolge komischer Figuren etwas oberflächlich. Ein besonderes Bühnenelement sollte den gelähmten Körper von Samuel Koch wie eine Marionette bewegen – doch sein Auftritt blieb kurz und enttäuschend. Maria Moling und Annette Paulmann bereicherten die Produktion mit musikalischen und puppenspielerischen Einlagen. Der russische Künstler und Regisseur Serge eröffnete den Abend mit einer Lecture-Performance über den "Kriegsunternehmer" Jewgeni Prigoschin. Okunevs Recherchen zur Soldatinnenkultur wurden nach einer Idee von Heiner Müller mit dem Publikum geteilt. Das "Schlachtmahl in sieben Gängen" präsentierte eine dialektische Auseinandersetzung zwischen Wallensteins und Prigoschins Erzählungen. Gockels Wallenstein verband historisches Drama mit zeitgenössischer Relevanz. Während das Publikum von der humorvollen Inszenierung und den innovativen Bühneneinfällen begeistert war, kritisierten einige Beobachterinnen die mangelnde Tiefe einzelner Figuren* und die unausgereifte Nutzung des Bewegungsapparats. Trotz dieser kleinen Schwächen regte die Produktion nachhaltige Diskussionen über Krieg, Macht und Liebe in historischen wie modernen Kontexten an.

Greuther Fürth siegt knapp gegen Bielefeld – doch die Abwehr bleibt ein Problem
Ein knapper Sieg bringt Hoffnung, doch 54 Gegentore in 23 Spielen zeigen: Ohne stabilere Abwehr wird der Klassenerhalt für Fürth zum Drahtseilakt. Kann Vogel die Wende schaffen?

Grüne starten Wahlkampf in Wörthsee: Kurswechsel oder Stillstand für Bayern?
Katharina Schulze warnt vor Rechtsextremismus, Benjamin Barho verspricht Solarrevolution und bezahlbares Wohnen. Doch können die Grünen Starnberg wirklich umkrempeln? Die Antwort liegt bei den Wählern.

RobBubbles viraler Clip entfacht Debatten über Influencer-Verantwortung
Ein einziger Moment bei 3:12 Minuten bringt das Netz zum Kochen. Doch was macht RobBubbles Kritik so brisant – und warum spaltet sie die Szene?
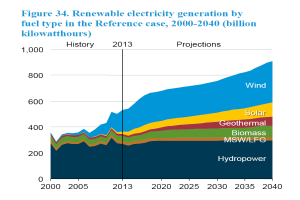
Europas Batterie-Berg wird zur Rohstoff-Chance – wie Recycling die Zukunft sichert
Alte Batterien als Schatzkammer der Zukunft? Ein EU-Projekt zeigt, wie KI und Robotik aus Elektroschrott wertvolle Rohstoffe machen – und warum Deutschland jetzt handeln muss. Die Lösung könnte nicht nur die Umwelt entlasten, sondern auch die Stromkosten senken.

Merz entfacht Debatte: Braucht Europa eigene Atomwaffen gegen US-Zweifel?
Ein riskantes Spiel mit der Sicherheit: Während Merz über Atomwaffen "made in Europe" spricht, klammert sich Deutschland weiter an US-Bomben. Warum die Diskussion jetzt neu aufflammt.

IWA OutdoorClassics 2026 setzt auf Krisenvorsorge und globale Sicherheitsthemen
Krisenfest in unsicheren Zeiten: Die IWA OutdoorClassics 2026 wird zur Plattform für Überlebensstrategien und militärische Resilienz. Was Aussteller und Redner wie Herbert Saurugg planen.

Söder polarisiert beim Politischen Aschermittwoch zwischen Show und Machtkalkül
Mit einer William-Wallace-Imitation sorgt Söder für Furore – doch hinter der Show brodeln private Angriffe und Spannungen mit der CDU. Was bedeutet das für Bayerns Kommunalwahlen?

Charli XCX' Mockumentary The Moment löst bei Berlinale-Premiere politische Kontroverse aus
Eine Mockumentary über die Musikbranche wird zum Polit-Skandal. Warum Charli XCX' Berlinale-Premiere plötzlich im Fokus der Kritik steht – und was die Aftershow mit Putin zu tun hat.
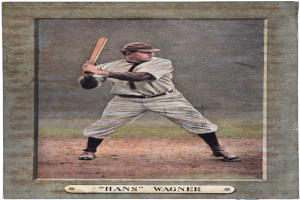
Gauting Indians verpflichten Top-Talent Jona Widmann für die DBL-Saison
Ein Fastball wie ein Blitz, WM-Erfahrung und ein Traumstart in die DBL: Jona Widmann bringt frischen Wind nach Gauting. Doch sein Weg führt bald in die USA – zum College-Baseball.

Love and Deepspace gewinnt den Besten Mobile Game Award auf der Gamescom, während frauenorientierte Titel auf der globalen Bühne auftreten
Auf der vergangenen Gamescom in Köln gewann Love and Deepspace, ein 3D-Romance-Mobilgame von Infold Games, den Besten Mobile Game Award und wurde somit

Erfahrung Diversity: Interkulturelle Woche bringt Menschen in Greifswald zusammen
Finden Sie die neuesten Nachrichten von der Stadtverwaltung und ihren nachgeordneten Institutionen hier.

Tobias Kratzer startet mit provokanter Schumann-Inszenierung in Hamburgs Staatsoper
Ein Intendant, der Grenzen sprengt: Kratzers erste Regiearbeit in Hamburg stellt Traditionen infrage. Wird sein provokanter Stil die Opernwelt verändern – oder spalten?